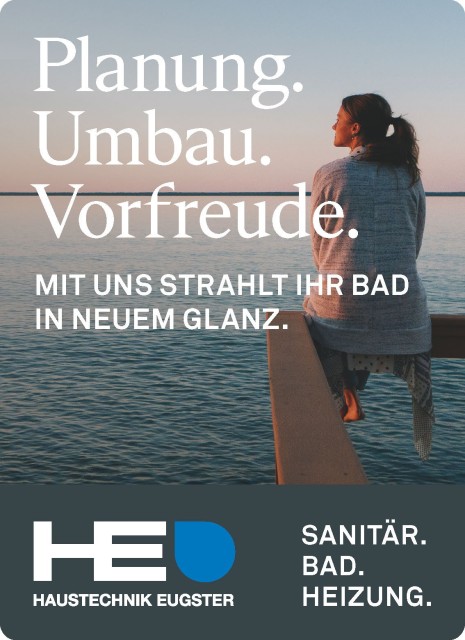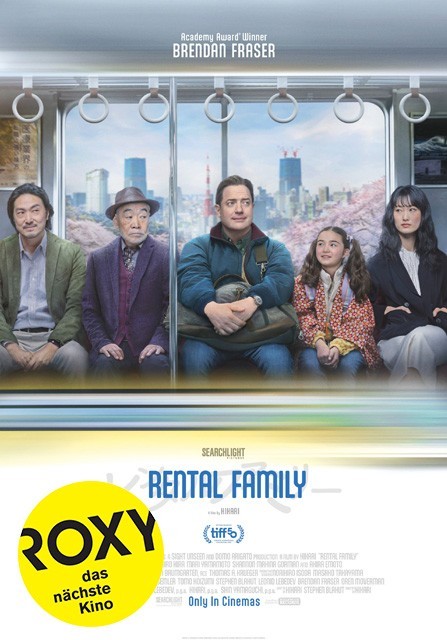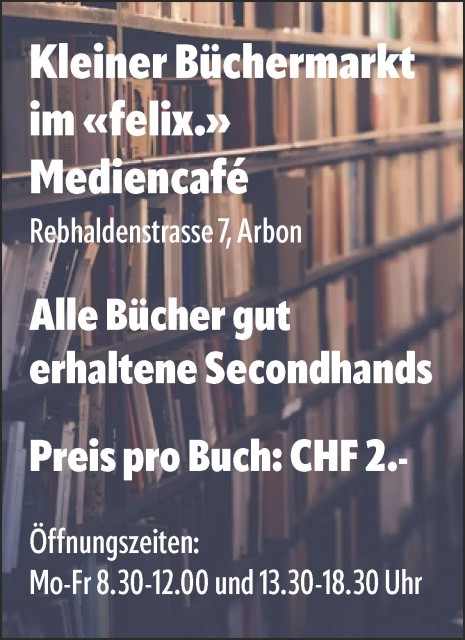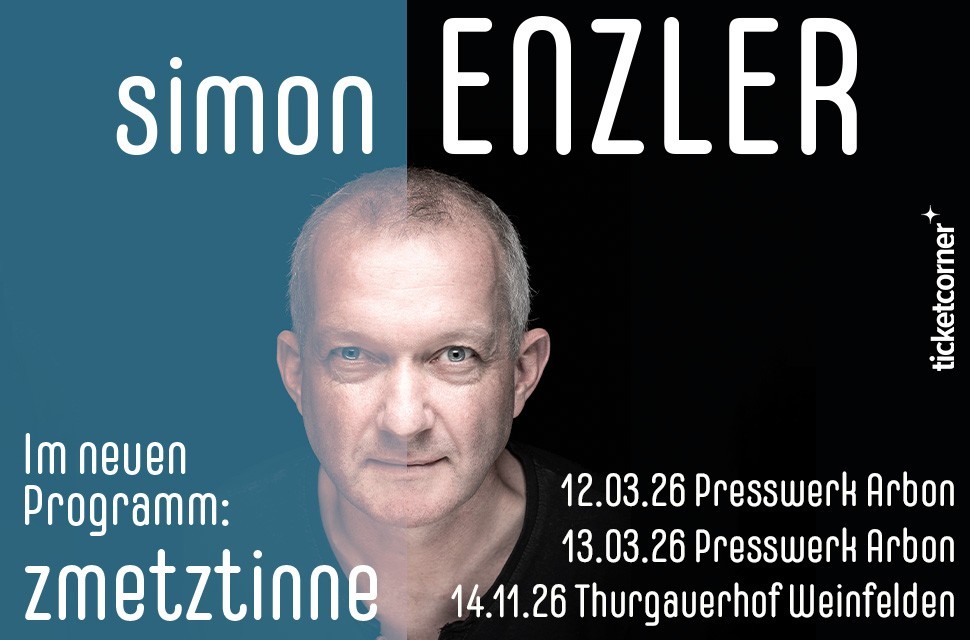Das Sterben leichter machen
Manuela MüllerNicolai Siefert, welches Verhältnis haben Sie zum Sterben?
Ein positives. Der Tod gehört zum Leben und das Leben zum Tod. Keiner ist davor gefeit. Ich nehme an, dass danach etwas Schönes kommen wird. Ausserdem sollte der Tod kein Tabuthema sein.
Sollte man sich also bereits «in der Blüte des Lebens» mit dem Tod auseinandersetzen?
Ja. Denn in der Blüte des Lebens hat man noch die Zeit dazu. Es ist besser, wenn man sich mit seinen Liebsten schon vorgängig über das Thema Tod unterhält, damit sie einen Plan haben, wie es weitergeht, wenn das eigene Leben wirklich einmal endet. Man schiebt die Gespräche über das Alter, die benötigte Hilfe und den Tod aber stattdessen immer gerne von sich weg.
Weshalb?
Viele wollen das Thema gerne verdrängen. Sei es aus Scham, aber auch aus Eitelkeit. Ich hörte zum Beispiel von 85-Jährigen, dass sie in ihrem Alter noch zu jung für eine Alterswohnung seien. Ich bin jedoch der Meinung, dass man die Möglichkeit auf Unterstützung nutzen soll, solange man sie hat. Das Leben wird irgendwann rückläufig. Man fängt klein an, wird grossgezogen und irgendwann ist man wieder auf Hilfe angewiesen. Unser Körper ist nicht so widerstandsfähig, um allem zu trotzen. Auf eine Geburt bereitet man sich vor, wieso nicht auf den Tod?

Welche Fragen stellen sich im Rahmen der Sterbebegleitung?
Unter anderem: War die- oder derjenige religiös? Wie soll die Bestattung ablaufen? Gibt es eine Feuer- oder Erdbestattung oder wollte der Verstorbene, dass seine Asche verstreut wird? Möchte sie oder er eine persönliche Botschaft in die Todesanzeige einfliessen lassen? Soll in der Kirche ein Lieblingslied gespielt werden? Oder sollen alle bunt statt schwarz gekleidet zur Bestattung kommen? Hauptsächlich geht es darum, das Sterben schöner und leichter zu machen.
Die meisten würden den Tod wahrscheinlich nicht mit den Worten schön und leicht bezeichnen. Wie gehen Sie vor, um Leichtigkeit in die ganze Thematik reinzubringen?
Indem ich dabei helfe, an Sachen zu denken, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel Kinder mit einzubeziehen, die auf der ganzen Welt verteilt wohnhaft sind oder an den Papierkram, der notwendig ist. Seien es Passwörter, die benötigt werden, Informationen für die Hinterbliebenen, allenfalls Abschiedsbriefe für die Angehörigen oder Telefonlisten mit den wichtigsten Kontakten.
Wie filtern Sie individuelle Bedürfnisse heraus?
Um den Menschen dahinter besser kennenzulernen, habe ich mir einen Evaluierungsbogen zusammengestellt. Ein Fragenkatalog, der mir hilft, herauszufinden, wie sich mein Gegenüber sein Lebensende vorstellt. Die Menschen sollen selbstbestimmt und würdevoll gehen dürfen. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle.
«Auf eine Geburt bereitet man sich vor, wieso nicht auf den Tod?»
Was beschäftigt die Menschen denn auf emotionaler Ebene?
Es geht ganz oft um Aufarbeitung, Ängste, Dankbarkeit aber auch um die letzten Wünsche. Es fällt vielen Menschen schwer zu gehen, da noch unerledigte Dinge im Raum sind. Manche erzählen mir ihre Lebensgeschichte, die Höhepunkte ihres Lebens, das ist sehr individuell. Viele versuchen die Situation auszuhalten, haben vielleicht auch eine kurze Panik und bitten um Unterstützung, auch um nicht alleine gelassen zu werden. Für mich ist es zudem immer eine sehr ehrenvolle Aufgabe.
Was motiviert Sie, die Trauer- und Sterbebegleitung anzubieten?
Viele ältere Leute haben niemanden mehr. Die Verwandtschaft ist nicht mehr da oder wie bereits erwähnt auf der ganzen Welt verteilt. Ich bin der Meinung, dass keiner von uns alleine von dieser Welt Abschied nehmen sollte. Zudem haben doch noch viele Angst vor dem Tod oder stellen sich komische Sachen vor, die dann passieren sollen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass der Sensenmann vorbeikommt, sich ein Fegefeuer entfacht oder ähnliches.
Wie kann man denn dem Tod den Schrecken nehmen?
Man sollte viel darüber sprechen. Viele sind sich erst bewusst, dass das Leben zu Ende geht, wenn der Tod zum Beispiel durch eine Diagnose kurz bevorsteht. Wenn man aber nach Einschätzung der Schulmedizin beispielsweise noch ein halbes Jahr zu leben hat, ist es aber schon «zu spät» sich Gedanken zu machen. Man sollte sich deshalb bereits vorher über das Thema unterhalten, denn auch bei plötzlichen Unfällen hat man keine Chance mehr, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen.
Wann haben Sie das erste Mal Erfahrung mit der Sterbehilfe gemacht?
Bei meiner Grossmutter. Zwischen uns bestand eine tiefe Verbundenheit. Als sie 98 Jahre alt war, habe ich sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet. Dies war aber nicht das Ende, denn für mich ist lediglich ihre materielle Hülle weg. Sie ist immer noch da und ich richte ab und zu noch Fragen an sie, denn in meinem Herzen lebt sie auch nach ihrem Tod weiter.
Wie ging es danach weiter?
Nebst der Begleitung meiner Grossmutter habe ich den Tod einer Bewohnerin der Giesserei, wo ich knapp sechs Jahre lang angestellt war, miterlebt. Ich bin auch dort bis zu ihrem letzten Atemzug geblieben und habe danach das Fenster geöffnet.

Das Fenster geöffnet?
Das ist ein alteingesessener Brauch, um der Seele eines verstorbenen Menschen den Weg nach oben in den Himmel freizumachen und diese nach oben steigen zu lassen.
Klingt auch für Sie nach einem emotionalen Thema...
Man muss die Trauer- und Sterbebegleitung mit Überzeugung machen, mit dem Herzen dabei sein und auch selbst eine gute Psychohygiene betreiben. Ich mache dies mit einem Spaziergang am See mit meiner Hündin Kaja, indem ich mich mit Kollegen austausche, oder eine Runde baden gehe. Zudem können auch wir Begleitpersonen Coachings und Supervisionen in Anspruch nehmen. Die Schicksale der Menschen, die ich betreue, bewegen, sie dürfen mich selbst aber auch nicht einnehmen. Man sollte deshalb auch immer ehrlich zu sich selbst, aber auch zu den Kunden sein, wenn man merkt, dass man nicht die richtige Ansprechperson in dieser Situation ist.
Was war der ausschlaggebende Punkt, die Trauer- und Sterbebegleitung zum Beruf zu machen?
Ich war knapp sechs Jahre in der Giesserei als Leiter Betriebsunterhalt und Hauswirtschaft tätig. Während dieser Zeit hatte ich viel mit älteren Menschen zu tun. Ich habe den Bewohnenden zu dieser Zeit viel in ihren persönlichen vier Wänden geholfen. Das brachte eine gewisse Verbundenheit und ein Vertrauen mit sich. Der tägliche Gang zur Giesserei fühlte sich an, wie wenn man immer wieder zur Familie zurückkehrt. In dieser Zeit habe ich bemerkt, dass viele der Bewohnenden in gewissen Situationen alleine dastehen. Zudem war ich etliche Jahre im Rettungsdienst, bin First Responder in Arbon und Roggwil und ebenfalls ehrenamtlich bei den Feuerwehren Arbon und Roggwil im Einsatz. Bei einer Messe für Pflegeutensilien, die ich mit Kollegen in Zürich besucht habe, stiess ich zufällig auf den Stand von «Soul Sense». Das ist die Schule, an der ich nun meine Ausbildung zum Sterbe- und Trauerbegleiter mit dem Ziel, Menschen während ihrer letzten Lebensphase zu unterstützen, absolviere. Ich fand es schon immer eine schlimme Sache, wenn jemand alleine gehen muss. Deshalb wollte ich diese Ausbildung machen.
Man kann also eine Ausbildung zum Trauer- und Sterbebegleiter absol-
vieren?
Ja genau und dafür muss man nicht mal bis nach Zürich fahren. Das Angebot gibt es bereits bei uns im Kanton Thurgau in Bürglen. Die Ausbildung zum Trauer- und Sterbebegleiter dauert zehn Monate. Dann kann man sich zertifizieren lassen. Zur Diplomierung fehlen dann noch fünf Begleitungen, eine Diplomarbeit, ein Vorbereitungsretreat und eine Prüfung.
«Es geht ganz oft um Aufarbeitung, Ängste, Dankbarkeit, aber auch um die letzten Wünsche.»
Was beinhaltet diese Ausbildung?
Die Ausbildung vermittelt umfassende Grundlagen im Umgang mit Menschen am Lebensende und ihren Angehörigen. Sie beinhaltet unter anderem Basiswissen zur Trauerbegleitung, zum Sterbeprozess sowie pflegerische Grundlagen. Hinzu kommen naturheilkundliches und spirituelles Wissen sowie der Umgang mit besonderen Situationen – etwa beim Begleiten von Kindern, die mit Tod und Abschied konfrontiert sind. Weitere Themen wie Selbstbestimmtheit, Abschiedsgestaltung, Bestattungsbeistand und Carebegleitung in Ausnahmesituationen sind ebenso Teil der Ausbildung. Ein Praxistag im Krematorium bietet die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Zudem würden mich anschlies-
send auch Kurse zum Thema Gebärdensprache interessieren.
Arbeiten Sie bei der Sterbebegleitung mit Organisationen zusammen?
Ich agiere als ein Rädchen von vielen. Man arbeitet eng in Verbindung mit der Spitex oder den jeweiligen Pflegefachpersonen zusammen. Leistungen, die jedoch von Fachpersonen ausgeführt werden müssen, kann ich nicht ausführen.
Um Situationen der Trauer zu überwinden, bieten Sie ein offenes Trauercafé in der Arboner Stadtbibliothek an. Wie kam die Idee hier in Arbon ein Trauercafé anzu-
bieten?
In Arbon gibt es kein offenes Trauercafé. Es gibt zwar kirchliche Angebote oder Angebote der Krebshilfe, jedoch können sich nicht immer alle damit identifizieren.
Wenn es im Trauercafé um das Thema Tod geht, beschäftigen sich die Besuchenden eher mit dem Leben oder dem Tod?
Wir sind im Trauercafé klar lebensbejahend. Mit den verschiedensten Themen wie dem Verlust einer geliebten Person, aber auch beispielsweise dem Verlust des Jobs ergibt sich so ein buntes Potpurri an Trauerereignissen, die alle ihren Raum brauchen. Unser Ziel ist es natürlich, dass die Besucherinnen und Besucher des Trauercafés nach zwei Stunden gestärkt die Stadtbibliothek verlassen und neue Möglichkeiten gefunden haben, um mit der eigenen Trauer umzugehen.