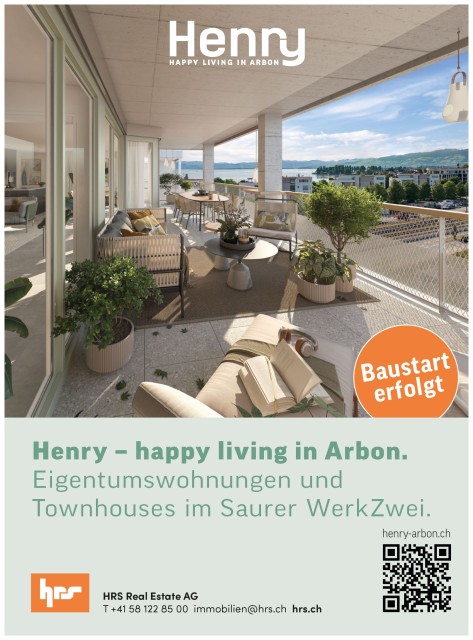«Den Mut haben, Hilfe zu holen»
Andrea Vonlanthen
Möchten Sie nochmals 15 sein?
Theresa Hirschberg: Ja – eine schöne Zeit! Wir wussten noch nicht über alles Bescheid und konnten darum noch viel entdecken und erleben.
Worüber haben Sie sich damals Sorgen gemacht?
Das waren zum Beispiel schulische Sorgen. Doch ich habe mit etwa 15 Jahren ein Praktikum gemacht in einer Einrichtung für beeinträchtigte Kinder am Bodensee. Dort habe ich zum ersten Mal einen Autisten getroffen. Er hat nicht gesprochen und sich selbst verletzt. Ich habe mir nicht unbedingt Sorgen gemacht, aber ich habe mich gefragt, wie ich ihm helfen kann. Dort habe ich mich entschlossen, Medizin zu studieren, um Menschen wie diesem Autisten helfen zu können.
300 000 Minderjährige in der Schweiz sind psychisch so belastet, dass sie Hilfe brauchen. Ist die Situation auch im Oberthurgau so dramatisch?
Es ist so, dass die Zahlen auch bei uns stark steigen. Wir haben einen hohen Anmeldedruck. Die Wartezeiten haben sich sehr verlängert. Früher waren es zwei Monate, in Romanshorn sind wir jetzt bei drei bis vier Monaten. Wir beobachten vor allem auch, dass es mehr dringende Fälle gibt und dass sie viel komplexer sind.
Jeder Teenager hat doch seine Sorgen. Wann reden Sie von einer psychischen Erkrankung?
Wenn Kinder und Jugendliche so stark beeinträchtigt sind, dass sie in ihrer Entwicklung gehemmt oder in ihrem Umfeld stark eingeschränkt sind, dann sollte man das ernst nehmen.
«Es gilt, die Gefühle der Jugendlichen ernst zu nehmen.»
Offenbar sind Mädchen stärker betroffen.
Die Jungen haben öfter externalisierte Störungsbilder, also ein nach aussen hin störendes Verhalten, die Mädchen häufiger nach innen gehende depressive und angstbezogene Störungen. Die starke Zunahme in den letzten zwei Jahren zeigt sich vor allem in depressiven Erkrankungen und Angststörungen. Darum hat sich der Anteil an Mädchen erhöht. Lange hatten wir einen höheren Anteil an Jungen. Die Jungen holen aktuell aber wieder auf.
«Die Robustheit der Jugendlichen nimmt ab», sagt ein Arboner Schulleiter. Woran liegt das?
Die Belastung der Jugendlichen hat insgesamt zugenommen. Da spielen Corona und der Krieg sicher mit. Corona war für alle eine Ausnahmesituation. Entwicklungsschritte werden behindert, wenn Kinder ihre Freunde nicht treffen können. Wichtig ist für einen Jugendlichen, dass er seine Ressourcen hat, seine Hobbys, seine vertraute Umgebung. Hier kann er seine Stärken und seine Robustheit aufbauen. Bei psychischen Krankheiten spricht man von einem Zusammenspiel zwischen Veranlagung, also der Genetik, und der Umwelt. Und wenn die Umwelt so zur Belastung wird, dann sind die anfälligen Jugendlichen stärker gefährdet.
Spielt auch der Leistungsdruck in der Schule mit?
Ich merke bei vielen Jugendlichen, dass sie unter einem grossen schulischen Leistungsdruck stehen und an den vielen Prüfungen leiden. Ob er in der Schule explizit zugenommen hat, kann ich nicht beurteilen. Einiges hängt auch wieder von der Veranlagung ab. Bei einer Aufmerksamkeitsstörung zum Beispiel müssen die Kinder viel mehr Energie aufwenden, um die gleichen Leistungen zu erbringen.
Mit welchen Problemen kommen die jungen Leute vor allem zu Ihnen?
Wir sehen ein komplexes Spektrum von Krankheitsbildern. Dazu gehören Aufmerksamkeitsstörungen mit oder ohne Hyperaktivität, Zwangsstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen und angstbezogene oder depressive Störungen. Die letzteren häufen sich stark. Dazu kann auch die Suizidalität gehören. Aktuell kommen Kinder und Eltern mit komplexeren «Paketen» zu uns. Es brennt oft bereits an mehreren Stellen.
Wie oft hören Sie von Suizidgedanken?
Relativ oft. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht darin, dies aktiv anzusprechen. Die Erfahrung zeigt, dass das Sprechen darüber entlastend ist und nicht zu einer Zunahme der Suizidgedanken führt. Suizidgedanken sollten immer ernst genommen und kinder- und jugendpsychiatrisch abgeklärt werden.

Wie viele Kinder und Jugendliche betreuen Sie momentan?
Das ist schwer zu erfassen, da wir Untersuchungen, Therapien, psychopharmakologische Begleitungen und Notfalltermine haben. Das bedeutet jeweils Behandlungen über verschiedene Zeiträume hinweg. Ich kann aber sagen, dass 2021 in den vier Ambulatorien Romanshorn, Münsterlingen, Frauenfeld und Weinfelden insgesamt 2559 Fälle behandelt wurden.
Wie gross ist Ihr Betreuungsteam?
In Romanshorn sind wir vier Psychologinnen und zwei Ärztinnen.
Wann sollte man auf jeden Fall Hilfe holen?
Wenn man merkt, dass ein Kind belastet ist, sollte man es nach seinem Ergehen befragen. Stösst man dann rasch an Grenzen, kann man sich zuerst an niederschwellige Angebote wie die Schulsozialarbeiter oder die «Perspektive Thurgau» wenden. Kommt man einfach nicht weiter, sollte man sich bei uns melden. Hilfe holen können Lehrer, Schulsozialarbeiter, die Familie oder andere Bezugspersonen. Üblich ist eine Zuweisung durch den Hausarzt oder eine direkte Anmeldung durch die Familie bei unserem Sekretariat.
Wie lange muss ein Arboner Jugendlicher mit ernsthaften Problemen auf eine Therapie warten?
Bei einem Notfall kann der Jugendliche noch am gleichen Tag zu uns kommen, also wenn von Selbstoder Fremdgefährdung ausgegangen werden muss. In weniger dringlichen Fällen, bei einer Konzentrationsstörung zum Beispiel, beträgt die Wartezeit aktuell drei bis vier Monate.
Wie gehen Sie vor, wenn ein Kind angemeldet ist?
Wir planen ein Erstgespräch, um das Kind und die Familie kennenzulernen und herauszufinden, wo das Problem liegt. Es kann zu einer Untersuchungsperiode mit fünf, sechs Terminen kommen. Dann führen wir mit der Familie ein Abschlussgespräch mit einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen. Es kann zu einer medikamentösen Unterstützung oder zu einer Therapie kommen. Auch eine stationäre Therapie kann einmal notwendig werden, zum Beispiel bei akuter Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung.

In einer nationalen Umfrage ist von einem «massiven Notstand in der Jugendpsychiatrie» die Rede. Gilt das auch für Romanshorn?
Wir haben im Thurgau und auch in der Region Romanshorn im Vergleich zu anderen Kantonen gut aufgestellte Angebote. Der Begriff «massiver Notstand» ist unpassend. Aber auch wir bemerken, dass die Fälle eben viel komplexer und oft dringlicher geworden sind. An einzelnen Standorten haben wir Wartezeiten von bis zu sechs Monaten.
Was tun Sie gegen diese schwierige Situation?
Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst Thurgau ist mit einem neuen Kriseninterventionsteam gestartet. So versuchen wir Abhilfe zu schaffen. Doch das ist nicht einfach, weil auch Therapieplätze fehlen. Für die Zukunft braucht es sicher mehr Ressourcen, das heisst mehr Räumlichkeiten und mehr Fachkräfte, damit wir die Versorgung gewährleisten können.
Da wären wir beim Thema «Fachkräftemangel».
Wir sind in einem interessanten Fach tätig. Doch es ist nicht einfach, die nötigen Fachkräfte zu finden. Ein Lichtblick liegt darin, dass sich Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten neu mit dem Anordnungsmodell selbständig machen können. Sie arbeiten neu auf Anordnung eines Arztes als selbständige Leistungserbringer. Das kann eine gewisse Entlastung bringen im Blick auf ambulante Therapieplätze.
In den sozialen Medien sind psychische Krankheitsbilder ein gefragtes Thema. Wie hilfreich sind Aufklärungen dieser Art?
Oft kommen die Menschen mit erstaunlich viel Wissen zu uns, manchmal auch mit Fehlinformationen. Was Kinder und Jugendliche da bei den sozialen Medien erfahren, entspricht oft nicht der Realität. Das kann verunsichern. Gleichzeitig kann hier auch sogenanntes Cybermobbing stattfinden, was dazu beiträgt, dass Jugendliche in eine Krise stürzen. Wichtig ist jedenfalls, dass wir jede Situation konkret besprechen.
«Wer seine Ressourcen stärken kann, kommt auch zu neuem Lebensmut.»
Was raten Sie der Schule und den Eltern, um die psychische Robustheit der Jugendlichen zu stärken?
Bezugspersonen und Bindungsangebote mit ehrlichen, authentischen Beziehungen in der Familie, der Schule und dem sozialen Umfeld sind sehr wichtig. Es gilt, die Gefühle der Jugendlichen ernst zu nehmen. Man sollte Grenzen und Strukturen vorgeben, aber auch Herausforderungen zulassen. Nur wer äussere Grenzen erfährt, kann auch innere bekommen. Und nur wer sich Herausforderungen stellt, erlernt Krisenresistenz.
Viele Menschen, nicht nur Jugendliche, fühlen sich überfordert und stossen psychisch an ihre Grenzen. Wo sollten wir ansetzen?
Schritt für Schritt. Wir sollten versuchen, Ruhe zu bewahren und den Mut haben, Hilfe zu holen. Hilfe holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und wir müssen uns immer wieder überlegen, was uns guttut. Dazu können Ruhe-Inseln gehören. Uns von den vielen negativen Nachrichten lösen und Medienpausen einlegen, um uns vor all den Katastrophenmeldungen zu schützen. Wir sollten uns fragen: Was kann ich tun, damit ich mich besser fühle?
Eine Krise jagt die nächste. Wie soll unsere Jugend zu neuem Lebensmut kommen?
(denkt lange nach) Indem sie den Fokus mehr auf das legt, was ihr Freude macht. Es gibt viel Negatives in dieser Zeit. Aber es läuft nicht alles schlecht. Es hilft sicherlich, den Fokus auf das Hier und Jetzt, auf Freundschaften, auf den Sport und andere positive Erlebnisse zu richten. Wer seine Ressourcen stärken kann, kommt auch zu neuem Lebensmut.
Was macht Ihnen selber Hoffnung in dieser Zeit?
In erster Linie das Zwischenmenschliche. Viele Kontakte zu einzelnen Menschen, auch zu belasteten Kindern und Jugendlichen, sind durchaus schön und machen mir Hoffnung. Auch belastete Menschen haben gute Momente und Ressourcen. Hoffnung macht mir auch die Erfahrung, dass man aus Krisen stärker werden kann. Das hat sich gerade während der Pandemie gezeigt.