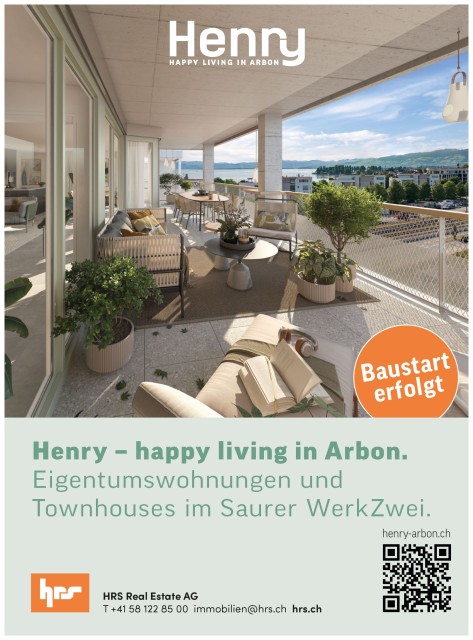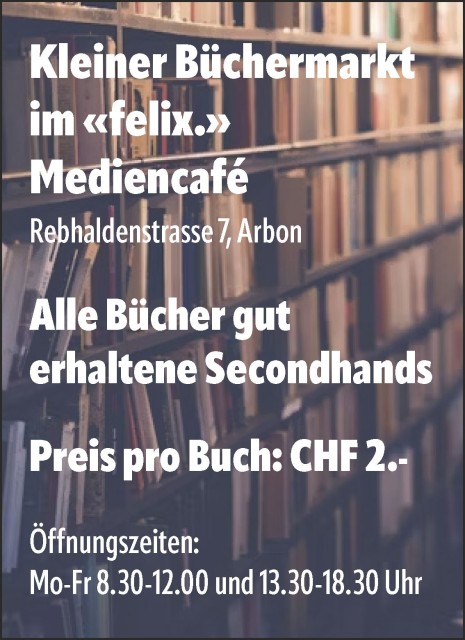«Ich habe keinen Fehler ausgelassen»
Kim Berenice GeserErich, was sagst du zum neuen Frauenfelder Zeitungsprojekt?
Die Grundidee ist gut. Wir haben jetzt eine kantonale Tageszeitung, die den lokalen Ansprüchen in keinster Weise mehr genügt.
Aber?
«Frauenfeld aktuell» soll eine Abo-Zeitung werden. Ich bezweifle, dass das der richtige Entscheid ist. Eine Zeitung, die sich im Mikrokosmos des Lokaljournalismus bewegt, muss aus meiner Erfahrung gratis sein, sonst funktioniert sie nicht. Aber wir sprechen hier von Frauenfeld. Da sind die Voraussetzungen natürlich noch mal anders. Wer weiss, vielleicht klappt das dort.
Manchmal muss man etwas wagen. Das hast du vor 25 Jahren auch gemacht. Der Sage nach entstand der «felix.» bei einem Glas Wein an der Olma.
Richtig. Die Idee trug ich schon länger mit mir herum. Ich hatte damals einen miesen Chef und die Nase voll. An besagter Olma traf ich dann auf Christoph Tobler, den damaligen Arboner Stadtammann, und wir begannen, diesen Gedanken weiterzuspinnen. Wir waren beide der Ansicht, dass es der Region guttäte, wenn hier eine Lokalzeitung entstehen würde, die ein bis zwei Mal die Woche erscheint. Denn die lokale Berichterstattung litt unter der immer kleiner werdenden Medienlandschaft in der Region. In der Folge machte ich mich also daran, alle anzuschreiben, die Rang und Namen hatten: Vereine, Kirchen, Gemeinden, Politiker. Ich wollte wissen: Ist das Bedürfnis nach einer Lokalzeitung da? Und dem war so.
«Ich war überzeugt, dass es eine zweite Zeitung braucht.»
Zu kündigen, weil man einen miesen Chef hat, ist das eine. Stattdessen eine eigene Zeitung zu gründen, aber ein ganz anderes Paar Schuhe.
Das ist so. Aber es hat mich gejuckt. Ich war mir sicher, ich kann das. Ich war allerdings auch der Einzige, der das geglaubt hat (lacht). Alle anderen hielten mich für verrückt.
Man gab dir nicht mal ein Jahr.
Weniger. Alle haben mir gesagt, wenn überhaupt, bringst du zwei Ausgaben heraus, dann bist du fertig. Wir hatten ja auch kein Geld für ein Jahr. Unser Startkapital war ein Jungunternehmer-Kredit der TKB über 50 000 Franken zu einem Zinssatz von 7 Prozent. Entgegen der weit verbreiteten Annahme erhielten wir nämlich keine Fördergelder der Stadt Arbon. Und auch die massgebliche Beteiligung der Gemeinden an den Verteilkosten kam erst 15 Jahre nach der Gründung zustande.
Dennoch hast du es durchgezogen.
Ich war überzeugt, dass es eine zweite Zeitung braucht. Und zwar nicht als Tageszeitung und gratis. Das hat mich meine Erfahrung beim «Anzeiger» gelehrt.
Ein zentraler Faktor war auch, dass «felix.» von Beginn an amtliches Publikationsorgan der Stadt Arbon war. Hättest du es sonst gemacht?
Nein. Ohne diese Vereinbarung hätten wir überhaupt keine Chance gehabt. Zum Glück konnten wir diesbezüglich auf den Rückhalt von Christoph Tobler zählen. Als amtliches Publikationsorgan gelangten wir in alle Haushalte der Region. Das war und ist ein zentrales Verkaufsargument für den «felix.». Und es machte uns zu einem wichtigen Partner für die Stadt. Deren «Amtliches» war zu diesem Zeitpunkt nur die «Thurgauer Zeitung», die als Abo-Zeitung schon damals nie sämtliche Haushalte im Gemeindegebiet abdecken konnte.
«Wir hatten in all den Jahren das Glück, unglaublich viel Hilfe und Unterstützung von Freunden zu erhalten.»
Du hast den Verlag MediArbon als Genossenschaft gegründet. Haben hier vor allem finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt?
Für mich war der genossenschaftliche Gedanke extrem wichtig. Einerseits natürlich, weil wir mit den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern eine gewisse finanzielle Struktur garantieren konnten, die uns in den Anfangsjahren auch immer wieder über die Runden half. Denn wir waren dauernd am Limit. Andererseits sollte die Genossenschaft der Bevölkerung auch signalisieren, dass man sich mit Ideen und Geschichten im «felix.» einbringen darf.
Die Anfangsjahre des «felix.» waren ein finanzieller Spiessrutenlauf. Wolltest du den Bettel nie hinwerfen?
Doch, immer wieder. Ich habe ja auch keinen Anfängerfehler ausgelassen. Nach einigen Jahren war ich dann fast so weit. Unsere Zahlen waren beschissen. Dann wurde noch eine meiner Mitarbeiterinnen schwanger und mein Treuhänder Sandro Biraghi meinte: «Erich, es ist eng. Ich kann das nicht mehr verantworten.» Da ging ich zu unserem Genossenschaftsrat Pablo Erat und sagte ihm, dass ich aufhöre.
Pablo Erat war einer deiner wichtigsten Verbündeten, nicht zuletzt deshalb, weil er mit der Branche vertraut war. Wie hat er reagiert?
Er sagte, das lasse er nicht zu und hat mir wieder Mut gemacht.
Allein mit Mut bezahlst du aber keine Rechnungen.
Das ist richtig. Wir hatten in all den Jahren das Glück, unglaublich viel Hilfe und Unterstützung von Freunden zu erhalten. Sei dies Joachim Rother, der uns unseren Businessplan erstellte; unser Treuhänder Sandro Biraghi, der nie alle Stunden verrechnete; Sandy Giger, Pablo Erat und sein Sohn Lukas, die für ein anständiges Layout sorgten; Köbi Hasler, der die Bildbearbeitung übernahm und meine Mitarbeitenden, allen voran Daniela Mazzaro, die dem «felix.» bis heute die Treue hält. Um nur einige aufzuzählen. Hätte ich diese guten Menschen nicht gehabt, wäre ich chancenlos geblieben. So konnten wir Schritt für Schritt die Qualität der Zeitung verbessern. Und mit den Jahren stieg auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Identifikation mit dem «felix.» fand immer mehr statt, wodurch wir stärker wurden und immer mehr gute und treue Inserentinnen und Inserenten gewannen, die uns irgendwann auf eine Ebene brachten, auf der wir überleben konnten.

So wurden aus den prognostizieren zwei bis drei Ausgaben gut 1150. Warum funktioniert das «felix.»-Konzept auch nach einem Vierteljahrhundert noch?
Weil wir vor 25 Jahren ein Konzept entwickelt haben, das federführend war. Wir haben eine Linie gefunden, mit der wir die unterschiedlichsten Themen unter einen Hut gebracht haben. Und wir haben diese konsequent durchgezogen. Wir sind ein «Chäsblättli» und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Im Gegenteil, es trifft sehr gut, was wir hier gemacht haben und immer noch machen. Wir haben uns Akzeptanz verschafft, weil wir zu den Menschen ins Wohnzimmer gehen und von der Eröffnung des Coiffeur-Salons über Baugesuche bis hin zu politischen Debatten über alles berichten, was die Region bewegt.
Was denkst du, wird es den «felix.» in 25 Jahren noch geben?
Gut möglich. Printmedien wurden immer wieder tot gesagt. Heute zeigt sich, all die neuen Formate kommen und gehen, der «felix.» bleibt.
Würdest du es noch einmal machen?
Wenn ich die Lehrstücke aus all meinen Fehlern mitnehmen könnte, ohne die Fehler noch einmal machen zu müssen, dann vielleicht. Aber ich weiss nicht, ob ich diesen Optimismus noch einmal aufbringen würde. Denn eigentlich hatten alle recht, die sagten: Du spinnst! (lacht)